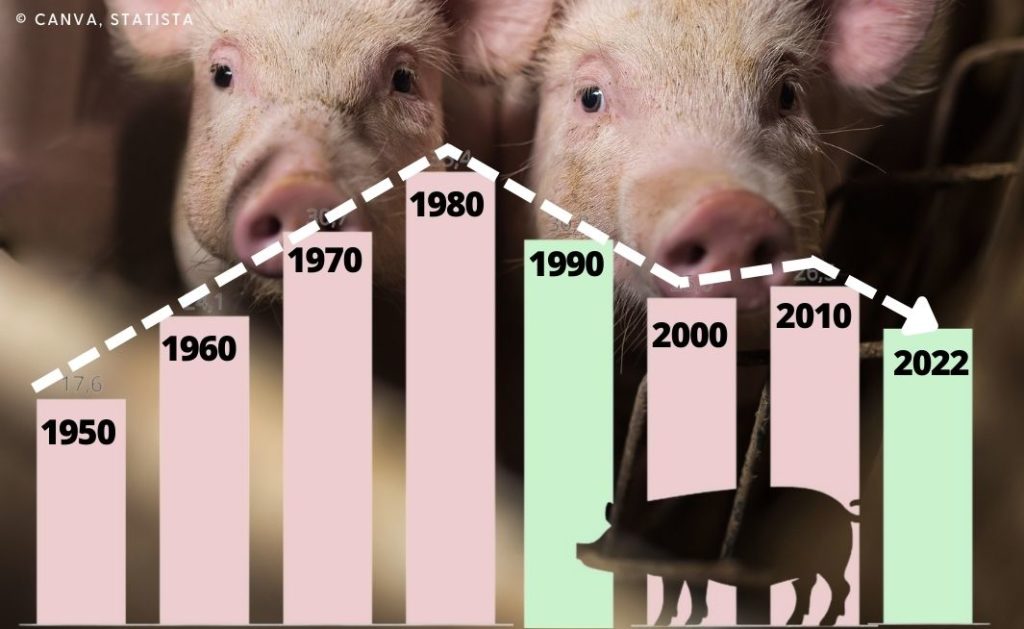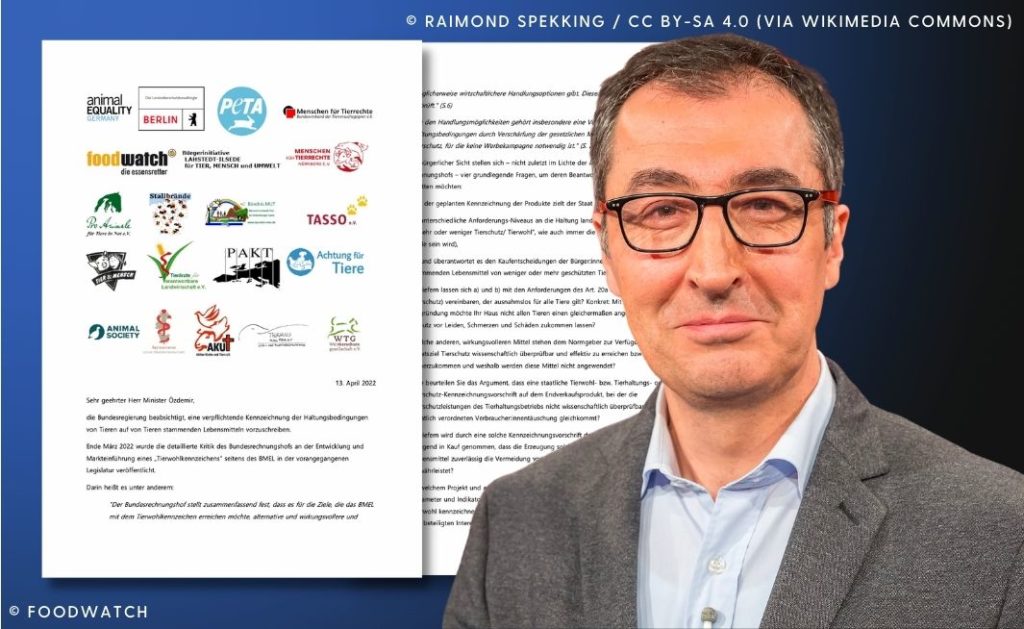6. Dezember, 2023
17. Dezember, 2022
Gefängnisstrafe für Tierquäler: Landwirte nach veröffentlichten Undercover-Aufnahmen verurteilt
14. Dezember, 2022
Mehr als 50 für Tierquälereien verantwortliche Landwirte erhielten weiterhin EU-Agrarsubventionen
11. Juli, 2022
Neue Ernährungsstrategie des BMEL: pflanzenbasierte Ernährung ist eines der Kernziele
9. Juli, 2022
Neuer Agrarpolitik-Bericht der Schweiz: Mehr Transparenz für Klima & Tierwohlauswirkungen
9. Juli, 2022
Niedrigster Schweinebestand seit der deutschen Vereinigung in 1990
2. Juli, 2022
Ermittlungsverfahren eingestellt: Über 60.000 Schweine starben 2021 bei Großbrand
19. April, 2022
Tierschutz- & Verbraucherorganisationen kritisieren geplante Haltungskennzeichnung
6. Februar, 2022
Green Deal: Rückgang der Viehzucht um 10-15%
6. Februar, 2022
Anbaufläche für Soja in Deutschland hat sich verdoppelt
30. Januar, 2022
Japanisches Startup erhält $7 Mio. für Cell-Ag-Infrastrukturplattform
30. Januar, 2022
Niederlande will „Nutztiere“ um ein Drittel reduzieren
23. Januar, 2022
Präsident des Deutschen Bauernverbandes: vegane Ernährung ist eine Chance
21. Januar, 2022